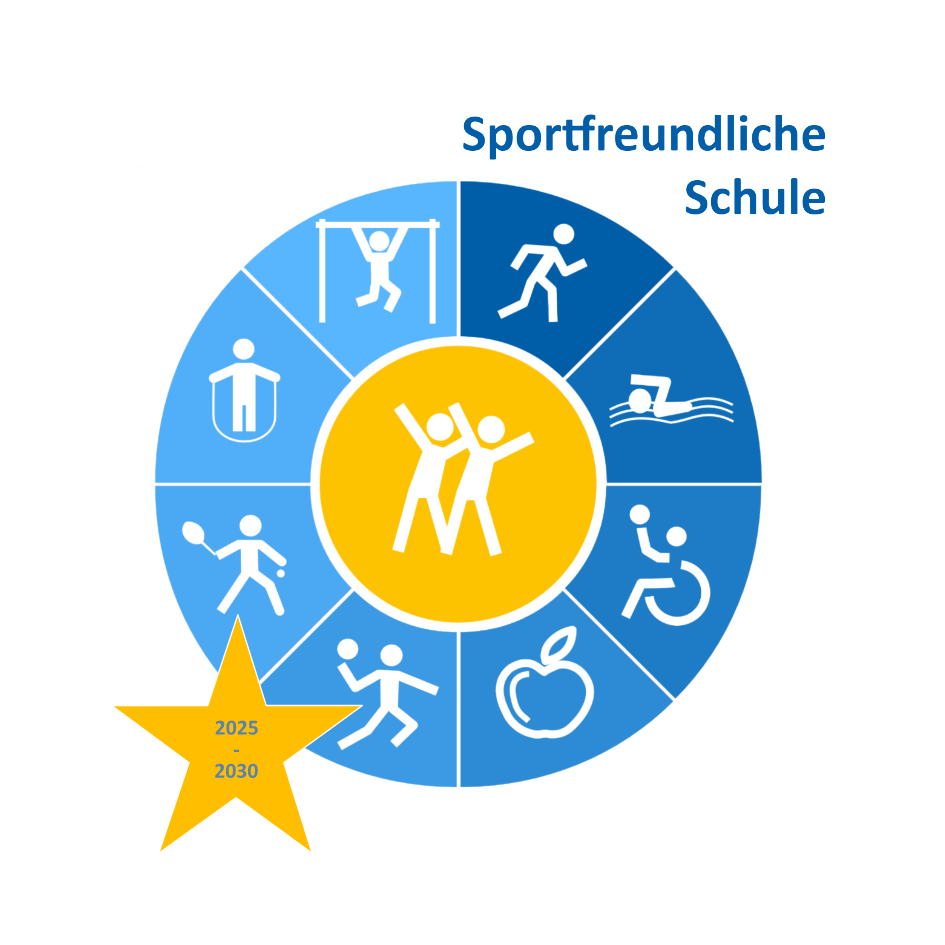Seminarfach Historische Spielfilme / Marcus Pfeifer
|
|
Viele haben den Filmwelterfolg „Im Westen nichts Neues“ auf Netflix oder im Kino gesehen. Abbildungen daraus haben es auch schon in neue Schulbücher zum Thema Erster Weltkrieg gebracht. Nicht viele wissen, dass Erich Maria Remarque, von dem die Buchvorlage für den Film stammt, in Lohne bei Wietmarschen Ideen für seinen internationalen Bestseller sammelte.
Foto: Gedenktafel in Lohne/Wietmarschen / M. Pfeifer |
Der weltberühmte Schriftsteller Erich Maria Remarque stammt aus Osnabrück und war Soldat im Ersten Weltkrieg. Als er 1917 nach nur einem Monat Fronteinsatz verletzt aus dem Kriegsdienst an den Schauplätzen des Ersten Weltkriegs entlassen wurde, waren es nicht zuletzt Gespräche mit anderen Veteranen im hiesigen Lohne im Rahmen seiner Tätigkeit als Hilfslehrer, die ihm seine Ideen für den Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ gaben. 1928 wurde der Roman erstmals veröffentlicht, und schnell wurde er ein Welterfolg. 1930 gab es nur zwei Jahre später schon die erste Hollywood-Verfilmung.
Schon im nächsten Jahr wurde Remarque für den Friedens- und den Literaturnobelpreis vorgeschlagen. Noch in diesen Tagen nannte der bekannte britische Historiker Niall Ferguson den Roman den „berühmtesten aller Antikriegsromane“. Nun erschien pünktlich kurz vor dem 125. Geburtstag Remarques im Jahr 2023 eine Neuverfilmung für Netflix, die im letzten Jahr mit vier Oscars ausgezeichnet wurde - sensationell für einen Film, der nicht aus den USA stammt! …
In diesem Jahr haben sich Mika Kamps und Maximilian Voet vom LMG drangesetzt, die beiden Verfilmungen von 1930 und 2023 im Rahmen des Seminarfachs Historische Spielfilme zu vergleichen. In diesem Interview sind die beiden bereit, ihre Eindrücke von ihrer Arbeit mit den beiden Filmen zu teilen.
MP: Habt ihr den Stoff des Films schon vor der Neuverfilmung 2022 angekannt?
MK/MV: Ja, mit Frau Loh (heute Frau Benen) haben wir die alte Version von 1930 am Ende der 8. Klasse gesehen, bzw. einen großen Teil davon. Das hat damals schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
MP: Welche Erwartungshaltung hattet ihr dann bei dem neuen Film?
MK/MV: Angesichts der fortgeschrittenen Filmtechnik hofften wir, dass die brutale Kriegsrealität anschaulicher und unmittelbarer rüberkommen würde, irgendwelche neue Aspekte hat oder vielleicht originalgetreuer wäre.
MP: Wurden eure Erwartungen erfüllt?
MK/MV: Interessant war die Neuverfilmung auf jeden Fall. Neu war insbesondere die Verschiebung des Filmbeginns in die Mitte des Ersten Weltkriegs.
MP: Haben euch beide Filme gleich gut gefallen? Wenn nicht, welcher war besser und warum?
MK/MV: Beide Filme haben uns gut gefallen. Beide haben ihre Stärken, wenn auch auf unterschiedliche Weise. Der neue ist actionreicher und die Verfilmung schon allein deswegen beeindruckender, weil sie in Farbe ist. Die Eindrücke von den Landschaften sind daher deutlich besser. Aber die Entfaltung der Storyline hat uns bei der Erstverfilmung besser gefallen. Prinzipiell überzeugt auch der Einstieg zu Kriegsbeginn wie in der Erstverfilmung mehr, weil damals die Kriegsbegeisterung auch wirklich noch stärker spürbar war. Um 1917 gab es ja doch schon viel mehr Frustration in der Bevölkerung und bei den Soldaten.
MP: Wie bewertet ihr die unterschiedlichen Einstiegsszenen?
MK/MV: Beide sind gut. In der Version von 1930 hat uns die Schulszene gut gefallen bzw. auch erschreckt, wie die Schüler letztlich alle von ihrem Lehrer erfolgreich angestachelt wurden, mit Begeisterung in den Krieg zu ziehen, dann aber sehr schnell unter der Brutalität der Realität des Krieges zu leiden begannen. Im zweiten Film geht es ja nicht direkt damit los, sondern mit dem Tod eines von vielen Soldaten auf dem Schlachtfeld, dessen Ausrüstung dann die Hauptfigur Paul Bäumer bekommt. So bekam man einen Eindruck davon, wie viele Soldaten schon gefallen waren, man fühlt die Anonymität des Kriegs, in der das Individuum nicht zählt.
MP: Was haltet ihr von den Schauspielern, insbesondere Felix Kammerer und Lew Ayres als Paul Bäumer?
MK/MV: Lew Ayres zeigt den Abhärtungsprozess, den Paul Bäumer durchläuft, sehr beeindruckend. Bei Felix Kammerer ist es eher die zunehmende Traumatisierung, die man bei Bäumer feststellt. Beides wirkt sehr authentisch und extrem gut visualisiert.
MP: Pauls Freund Kat spielt in beiden Filmen ja eine jeweils ganz andere Rolle. Wie bewertet ihr die beiden unterschiedlichen Darstellungen?
MK/MV: Ja, in der ersten Verfilmung ist Kat der kriegserfahrene Koch, der den neuen Soldaten einige gute Tipps geben kann, in der Neuverfilmung sind die beiden eher gleichaltrig. Beide Male ist Kat eine tragende Rolle an der Seite von Paul, die überzeugt und dessen Schicksal einem nahegeht.
MP: Was haltet ihr von der Szene im Bombentrichter, die in beiden Filmen vorkommt - als Bäumer erst einen französischen Soldaten verletzt, dann aber ein schlechtes Gewissen bekommt und beginnt, sich mit dem schon Halbtoten zu unterhalten beginnt?
MK/MV: Ja, das war eine der besten und überzeugendsten Szenen. Sie zeigt, dass auf beiden Seiten die gleichen Menschen kämpfen. Alle leiden, es gibt keinen wirklichen Gewinner, und Anlass für jede Menge Selbstzweifel am eigenen Töten. Als Bäumer die Familienfotos des französischen Soldaten sieht, merkt er, dass das auch ein ganz normaler Familienvater war.
MP: Remarque hat sein Buch, die Grundlage der Verfilmungen, als eigentlich unpolitisch bezeichnet. Stimmt ihr dieser Aussage zu?
MK: Beide Verfilmungen jedenfalls sind meiner Ansicht nach schon deutlich Anti-Kriegsfilme und damit auch politisch, auch wenn sie nicht direkt für oder gegen eines der beteiligten Länder Stellung nehmen. Die Botschaft ist, dass die vom Krieg betroffenen Menschen im Mittelpunkt stehen. In der Verfilmung von 1930 wird das in der Diskussion über die Kriegsursachen unter dem Baum sehr deutlich. Darin werden Entfremdung von und Zweifel an den Herrschenden erkennbar, das sind deutlich gesellschaftskritische Züge.
MP: Haltet ihr die Einbeziehung der Waffenstillstandsverhandlungen für überzeugend bzw. gelungen?
MV: Na, ja, der deutsche Verhandlungsführer Mathias Erzberger wirkt schon etwas schwach und trägt sein Herz sehr auf der Zunge, wenn er sogar dem französischen General Foch gegenüber sehr offenherzig von seinen Sorgen um seine Soldaten erzählt. Aber es ist schon okay, das prinzipiell zu thematisieren.
MP: Kann man die nach Ansicht des renommierten deutschen Historikers Sönke Neitzel nicht authentischen Szenen zum Kriegsende sinnvoll interpretieren? Ein General besteht ja darauf, dass am 11.11. 1918 noch bis zum Inkrafttreten des Waffenstillstands um 11 Uhr weitergekämpft wird. Nur deswegen stirbt Paul Bäumer im Film. Nicht nur Neitzel bestreitet aber, dass das jemals so stattgefunden hat.
MV: Zunächst einmal halte ich diese Szenen für wichtig im Film, man kann gerade daran erkennen, dass der Krieg zu nichts führt. Es ist es gut zu zeigen, dass es in der deutschen Politik viele gab, die aus Überzeugung gegen die Weiterführung des Krieges waren, der General steht für die unnachgiebige Haltung der militärischen Eliten bis zum Schluss.
MP: … wie sie sich ja auf jeden Fall auch bei dem Himmelfahrtskommando der Marine zeigte, die Ende Oktober noch einen aussichtslosen Angriff auf England starten wollte, wogegen sich dann die Matrosen wehrten und damit die die Novemberrevolution in Deutschland auslösten. … Sollte eurer Ansicht nach denn der Film bzw. sollten die Filme in Schulen gezeigt werden? Welchen würdet ihr ggf. vorziehen?
MK/MV: Wir halten beide Filme für extrem wertvoll für die Allgemeinbildung eines jeden. Nicht unbedingt im Hinblick auf Wissensvermittlung, sondern eher für die Wertevermittlung, um die Schlechtigkeit des Krieges allen eindrücklich vor Augen zu führen, bei dem alle Beteiligten nur verlieren
MP: Vielen Dank für das Gespräch!